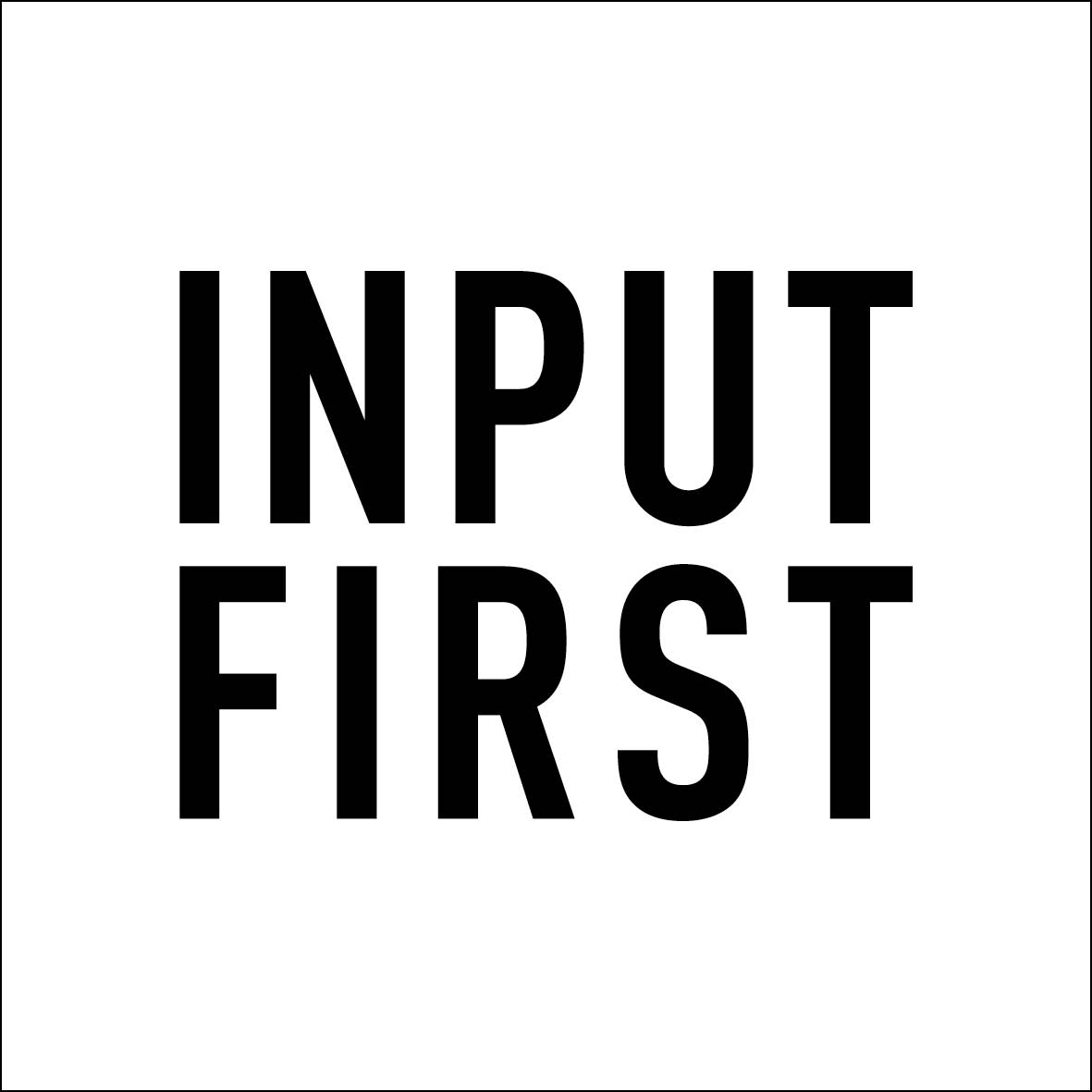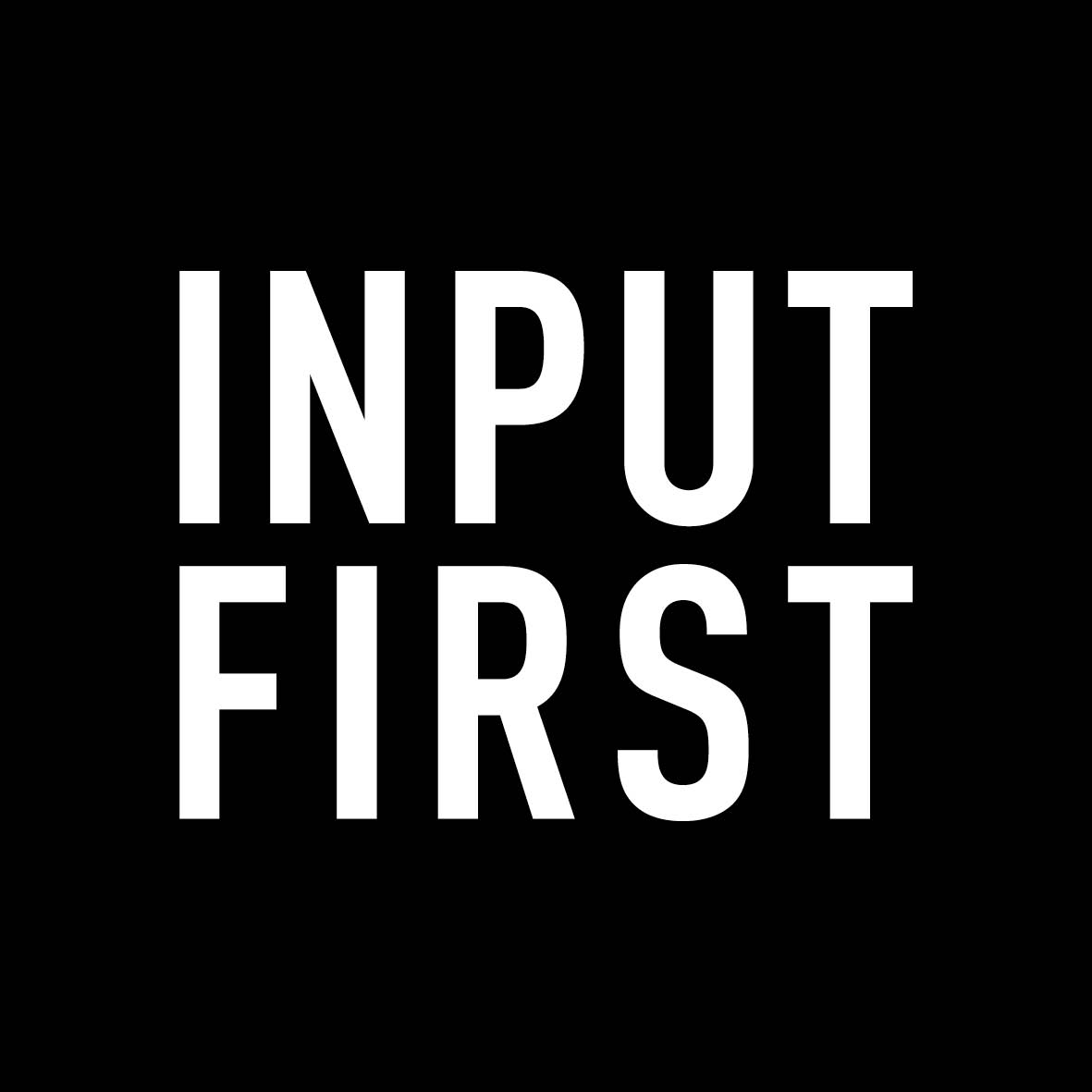Sensorik vor Motorik

Nur was ich fühlen kann, kann ich bewegen!
Sensorischer „Fühl-” und motorischer „Bewegungs-” Kortex liegen im Gehirn nah beieinander. Der Grund hierfür ist, dass beide in sehr enger Kommunikation miteinander stehen. Beide Areale sind im konstanten Austausch von Informationen um Bewegungen zu realisieren. Wenn eine Trainingseinheit beginnt, müssen dementsprechend einige Areale „aufgeweckt“ werden um eine verbesserte Bewegungsqualität zu gewährleisten. Durch sensorische Arbeit werden die Repräsentationen dieser Körperstellen im Gehirn wieder aktiviert. Diese Aktivierung ist notwendig da nach einer Phase der Inaktivität die neuronalen Karten im Kortex heruntergeregelt werden. Solche Maßnahmen werden im Gehirn ständig ausgeführt: Einige Areale sind aktiv während andere inaktiv sind. Durch ausbalancierte An-und Abschaltung passt sich das Gehirn an den aktuellen Aktivitätsgrad an und spart so eine Menge Energie. Hierdurch kann es den Fokus entsprechend auf die aktuell ausgeführte Aufgabe lenken. Ergo: Wenn ich vor dem PC sitze kann mein Gehirn die Kommunikation mit dem Körper vernachlässigen um mehr Energie in andere Hirnareale zu lenken, die die spezifische Aufgabe der Arbeit vor dem Bildschirm gewährleisten (z.B. Konzentration).
Ein kurzes Beispiel: Morgens nach dem Aufstehen (lange Phase der Inaktivität) fühlen sich die Füsse meist steif und holzig an. Dieses Gefühl wird besser je länger wir uns bewegen, weil jetzt über konstantes Bewegungsfeedback die neuronale Karte des Fußes wieder mit Information versorgt wird und damit im Gehirn klarer als zuvor erscheint. Wenn der Fuß sich steif anfühlt (momentan schlechte Sensorik) kann dieser auch nur unzureichend bewegt werden, weil die neuronale Bahnung herunter geregelt ist. Jedes einzelne Gelenk im Fuß (von den Zehen- über die Fußwurzel bis zu den Sprunggelenken) hat eine spezifische Aufgabe an der Bewegung mitzuarbeiten um einen flüssigen Gang mit optimaler Kraftübertragung zu gewährleisten. Wenn diese 28 (!) Fußknochen nicht sauber zusammen arbeiten, fühlt sich die Bewegung steif an, da das Gehirn zu wenig Informationen aus der unscharfen Kortexkarte ermitteln kann. Das Orchester der Knochen im Längs- und Quergewölbe kann so nicht wirklich sauber die Bewegungssinfonie spielen was andere Gelenke (Knie- und Hüftgelenke) dazu veranlasst die fehlende Mobilität im Fuß zu kompensieren. Wenn dieser Zustand (z.B. durch Innaktivität nach Verletzung) lang genug anhält, wird die Kommunikation des Fußes zum Gehirn immer schlechter und somit die neuronale Repräsentation des Fußes unschärfer was direkte negative Folgen auf die Bewegungsfähigkeiten hat (siehe Beitrag ‘Das Alarmsystem).
Ein Selbstexperiment
Um diesen Effekt zu verdeutlichen hier ein kleines Experiment: Gehe ein paar Schritte durch die Wohnung, setze dich dann hin und aktiviere 20 Sekunden lang deinen linken Fuß sensorisch (Sprunggelenk, Sohle, Zehen, Ballen, Spann und Ferse) mittels Reiben und Klopfen. Wichtig ist dabei, dass du die Augen schließt und bewusst in den Fuß hineinfühlst. Hierdurch wird hirnintern noch mehr Energie auf die Repräsentation des Fußes gelenkt. Jetzt gehe nochmal ein paar Schritte und vergleiche das Gefühl und die Bewegungsfähigkeit von linken und rechtem Fuß. Erstaunt? Der Fuß sollte nun deutlich weicher und flüssiger abrollen. Du hast jetzt nichts anderes gemacht als die Karte deines Fußes im Gehirn von Analog auf HD umzustellen. Dieses einfache „Was ich nicht fühlen kann, kann ich nicht bewegen“-Konzept kann auch anders in „nur was ich detailliert und differenziert fühle, kann ich auch optimal bewegen“ umformuliert werden. Dieser „Soforteffekt in der Geschwindigkeit des Nervensystems“ lässt jedoch bei erneutem Nichtgebrauch rasch wieder nach. Um die Kortexkarte eines Körperteils nachhaltig und optimal zu schärfen bedarf es Aktivierung nach den Regeln neuronaler Plastizität.
Weitere Literatur – eine beispielhafte Studie zum Thema sensorischer Input
Rosenkranz, Karin, Rothwell, C John. The effect of sensory input & attention on the sensorimotor organisation of the hand area of the human motor cortex. Sobell Department of Motor Neuroscience & Movement disorders. J Physiol.2004.069328